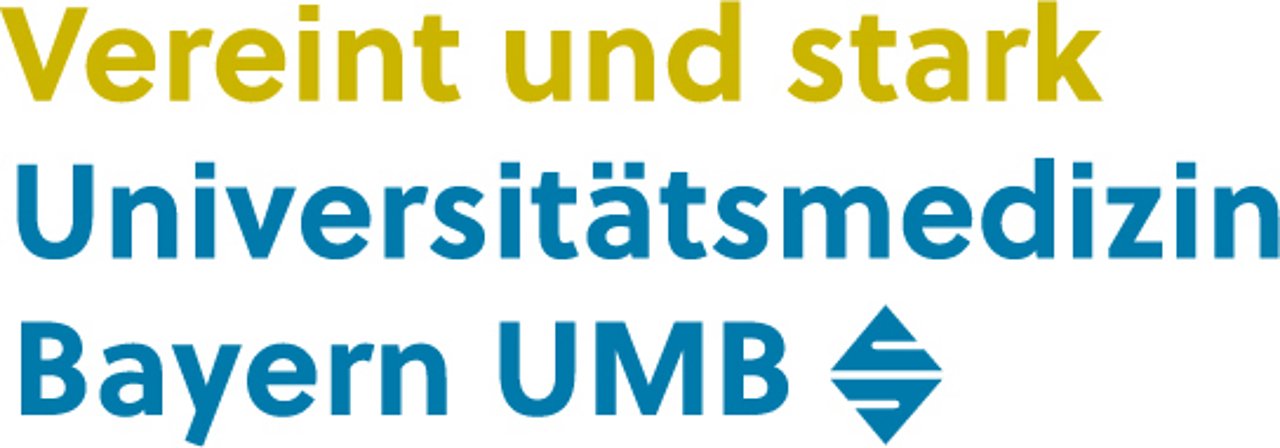In der Ruhe des Waldes warten tierische Therapeuten auf menschlichen Besuch. Hier, auf der Umweltstation Jugendfarm, finden Begegnungen statt, die Lebenswege verändern können.

Auf einem Kärtchen notiert Patientin Maria Pohl (Name von der Redaktion geändert) ihre Ziele für den heutigen Vormittag: Sie möchte sich entspannen, vielleicht etwas Neues auspro-bieren. Wenn ihre Gedanken hin zu ihrem Bruder und ihrem Vater driften, sei sie oft angespannt, berichtet die junge Frau. Fachärztin Dr. Judith Walloch von der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik des Uniklinikums Erlangen schlägt eine „tierische“ Achtsamkeitsübung vor. Sie führt Maria Pohl an der Feuerstelle vorbei, an der gerade eine Grundschulklasse verschiedene Baumblätter studiert. Vorbei am Hühnerstall und an den Kaninchen, die zwischen Freigehege und Schutzhütte hin und her hoppeln. Schließlich betreten Judith Walloch und ihre Patientin das Areal für die erste Übung: Hier steht Greta – ein weißes Schaf mit schwarzem Gesicht und ebenso schwarzen Ohren. „Versuchen Sie einfach, drei Minuten lang im Moment zu sein. Wenn Sie merken, dass Sie gedanklich wieder bei Ihrem Bruder landen, holen Sie sich zurück ins Hier und Jetzt“, instruiert Judith Walloch. „Die Zeit läuft“, sagt sie und startet ihre Handystoppuhr. Ruhig steht die Patientin nun neben Greta und streichelt sie vorsichtig an Kopf und Rücken.

Begegnungen wie Medizin
Das Schaf steht still und genießt. In einigen Metern Abstand geht Judith Walloch neben einem Haufen zersägter Birkenstämme in die Hocke und beobachtet die Szene. Schafe haben einen ruhigen und friedvollen Charakter, weshalb sie sich gut für die tiergestützte Therapie eignen. Aber auch andere Haustiere erlauben heilsame Erfahrungen. Um diese erlebbar zu machen, nimmt Dr. Walloch ihre erwachsenen Patientinnen und Patienten regelmäßig mit auf die Umweltstation Jugendfarm im Erlanger Meilwald. Hier freuen sich neben Schafen auch Ziegen, Esel, Ponys, Kaninchen und Hühner über Gesellschaft. „Wir machen dieses freiwillige Angebot allen Patientinnen und Patienten unserer psychiatrischen Institutsambulanz, und es kommt sehr gut an“, sagt Dr. Walloch und betont: „Ein Tier kann ähnlich gut wirken wie Antidepressiva oder Blutdrucksenker oder den Effekt dieser Medikamente unterstützen.“

Tiere als Türöffner
Die drei Minuten mit Greta sind um. „Es war schön, das Schaf zu streicheln“, resümiert Maria Pohl. „Ich habe mich ganz darauf konzentriert. Seit ich die Tiertherapie mache, spüre ich die unterschiedlichen Fellarten ganz extrem. Schaf, Esel, Hund – alle sind unterschiedlich.“ Ob Depressionen, Ängste, Traumata, Zwangsstörungen, Demenz oder Schizophrenie – die tiergestützte Therapie kann bei allen psychischen Beschwerden eingesetzt werden. „Tiere fordern uns auf, hier und jetzt präsent zu sein. Ein Pferd wendet sich zum Beispiel oft ab, wenn es merkt, dass sein Gegenüber nicht bei der Sache ist. So ein großes Tier zu führen, wie wir das hier manchmal im Rahmen von Spaziergängen machen, stärkt Selbstwirksamkeit und Vertrauen, und ich kann dabei zum Beispiel üben, Grenzen zu setzen“, erklärt Judith Walloch. „Die Tiere spiegeln mir meinen inneren Zustand“, hatte eine Teilnehmerin der Therapiegruppe einmal gesagt. Menschen mit Haustieren und Forschende beobachten, dass etwa Hunde eine Situation verlassen, wenn Ärger in der Luft liegt, und sich ihren Besitzern zuwenden, wenn diese Trost brauchen. Vierbeinige Begleiter können den Tag strukturieren und motivieren, etwa zu Bewegung an der frischen Luft. Außerdem minimieren sie Stress, senken den Puls und verbessern die Stimmung in einer Gruppe. Demenzkranken nehmen Tiere die Unruhe, bringen sie zum Lächeln und machen sie wieder zugänglicher.
„Gerade für Menschen, die Traumatisches erlebt haben, die depressiv sind oder Schwierigkeiten haben, sich mit Worten auszudrücken, öffnen Tiere Türen“, erläutert Dr. Walloch. Sie streicht über Oles Ohren. Liegend lehnt der Schafbock an einem Zaun und erinnert mit seinem weißen Kopf und den großen schwarzen Ringen um die Augen etwas an einen Panda. „Tiere erlauben eine nonverbale Kontaktaufnahme, lassen sich berühren und stellen so Nähe und Bindung her. Sie lassen uns das Leben spüren“, sagt die Fachärztin und lächelt, während sie Ole betrachtet. Der Unterkiefer des Schafes bewegt sich rhythmisch im Kreis, während seine Zähne frische Brennnesseln zermalmen. Tiere berühren unsere Seele und können Emotionen oder Handlungen auslösen, die im Umgang mit Menschen manchmal nicht möglich sind. Einem Tier gegenüber zeigen sich Reaktionen oft ganz intuitiv, spontan und ungefiltert. „Es kann absolute Freude auslösen, wenn eine Katze aus freien Stücken zu mir kommt oder mir ein Kaninchen aus der Hand frisst“, sagt Judith Walloch. Ebenso unmittelbar können sich aber auch Enttäuschung oder Ärger zeigen, wenn der Tierkontakt nicht so läuft wie erhofft. Auch hieraus gewinnen Therapeutinnen und Therapeuten wichtige Erkenntnisse.

Selbst etwas geben
„So, jetzt gehen wir mal rüber zu den Ponys“, richtet sich Dr. Walloch an ihre Patientin. Interessant ist, wer sich auf der Jugendfarm welches tierische Gegenüber aussucht: Scheut jemand Herausforderungen und wählt deshalb ein besonders folgsames Tier? Oder möchte die Person mit einem weniger kooperativen Esel Mut beweisen? Maria Pohl soll sich nun für eines der Pferde entscheiden: die besonnene Jerma, den eher frechen Guus oder den aufmerksamen Fengur. Die zurückhaltende junge Frau wählt Jerma. Judith Walloch führt das Pony an einem Strick aus dem eingezäunten Bereich hinaus auf den Vorplatz. Der Kopf des hellbraunen Tieres reicht der Patientin bis zur Schulter. Die Ärztin, die selbst ein Pferd hat, demonstriert nun, wie die Mähne gebürstet und das Fell gestriegelt wird. Behutsam streicht Maria Pohl mit einer Bürste über Jermas Flanke und Hüfte. „Gut so“, bekräftigt sie die Therapeutin. Dann entfernt sie sich einige Meter und lässt die Patientin einen Augen-blick mit dem Pony allein. Abseits des Geschehens erklärt Judith Walloch: „Wenn ich ein Tier striegele, streichle oder füttere, kann ich selbst etwas geben. Ich erkenne, dass ich nicht nur bedürftig bin, sondern auch fürsorglich sein kann.“ Dann wendet sie sich an Maria Pohl: „Von hier aus kann ich sehen, dass Jerma die Augen geschlossen hat und die Berührung richtig genießt. Ihre Unterlippe zittert leicht – das macht sie immer, wenn sie total entspannt ist.“ Schließlich erläutert Dr. Walloch noch das Putzen der Hufe: wie man zuerst mit der Hand am Bein des Pferdes hinabfährt, ihm das Kommando „Huf“ gibt, das Bein abhebt und dann den Huf mit einem Auskratzer von Schmutz und Steinen befreit. Als der Fuß bei Maria Pohl partout nicht abheben will, hilft ihr Judith Walloch. „Zack! Da haben wir das Bein. Jetzt können Sie halten und ich kratze. Dann wechseln wir.“ Maria Pohl, die eigentlich immer nervös ist, wenn sie neue Aufgaben bewältigen soll, kommt am Ende der Einheit zu dem Schluss: „Ich war ruhig, weil das Pferd ruhig war.“

Von der Farm ins Leben
„Die Patientinnen und Patienten erlangen durch die Therapie neues Selbstbewusstsein, bauen Ängste ab, finden Ablenkung, Entspannung, aber auch Sinn. Manche erkennen, wie gut ihnen ein Tag in der Natur und mit Tieren tut, und sie begeben sich danach öfter in solche Situationen. Andere schaffen sich sogar selbst ein Tier an“, fasst Judith Walloch zusammen. Nach den Tierbegegnungen gilt es, die gemachten Erfahrungen aufs Leben anzuwenden. Die positiven Erlebnisse, die Maria Pohl jetzt in der nachträglichen Reflexion noch einmal auf ein Kärtchen schreibt, darf sie sich nun zu Hause an den Kühlschrank oder an die Pinnwand heften. „Damit Sie sich an den heutigen Tag erinnern und daran, wie Sie bestimmte Situationen gemeistert haben“, ermutigt sie Dr. Walloch. Nächsten Montag will Maria Pohl wieder mit in den Meilwald kommen, um Ole, Greta und Jerma zu begegnen – und ein Stück weit auch sich selbst.
Bilderserie zur Ausgabe
Tiergestützte Therapie auf der Umweltstation Jugendfarm – tierische Eindrücke aus dem Erlanger Meilwald
Text und Fotos: Franziska Männel/Uniklinikum Erlangen; zuerst erschienen in: Magazin „Gesundheit erlangen“, Frühling 2023
Biophilie …
… beschreibt das Bedürfnis des Menschen, sich mit anderen Formen des Lebens (Tiere, Natur) zu verbinden. Schon Babys interessieren sich mehr für Tiere als für leblose Dinge.
Patientenstimmen
- „Hilfreich war die Erfahrung, dass ein großes Tier meinem Willen folgt.“
- „Mein Ziel: Vertrauen zu mir durch Vertrauen durch die Tiere.“
- „Diese Art von Therapie kann man gut ins Leben übertragen.“
- „Wenn ich mich auf das Tier konzentriere, kann ich kurzzeitig alle Sorgen und Probleme vergessen.“
Hunde und Schnecken
In der Erlanger Psychiatrie kommen gelegentlich auch Therapiehunde und Achatschnecken zum Einsatz. Hunde spüren Stimmungen und verbessern die Gruppenatmosphäre. Die großen Achatschnecken eignen sich gut für Beobachtungsübungen, denn auch sie strecken den Kopf nur aus dem Haus, wenn sie sich in einer ruhigen und sicheren Umgebung wähnen.
Soziale Kompetenz
Die Gruppentherapie für Psychiatriepatientinnen und -patienten des Uniklinikums Erlangen findet seit 2017 auf der Jugendfarm statt. Mit dabei sind im Durchschnitt fünf Personen. So sind auch Übungen in Kleingruppen möglich, die die soziale Kompetenz schulen.