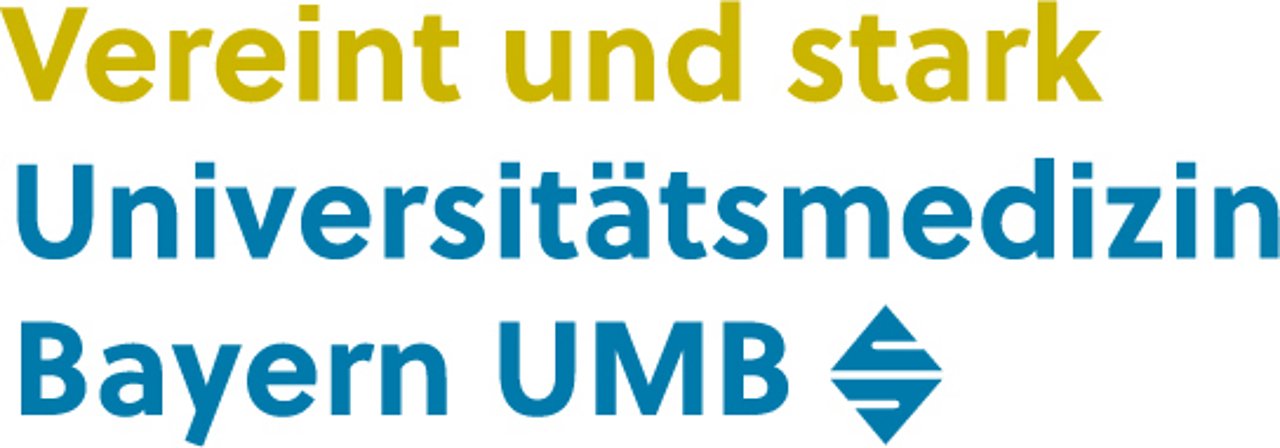Blinzeln, räuspern, schniefen, wiederkehrende Bewegungen: Viele Menschen haben Tics. Bei Kindern beginnen sie meist zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr. Zur Störung werden sie, wenn sie Betroffene oder ihr Umfeld belasten.
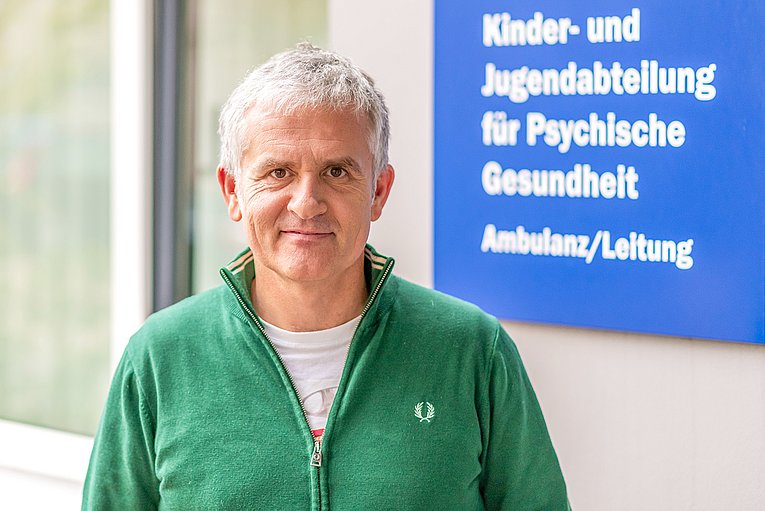
Herr Prof. Kratz, wie erklären Sie Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, was Tics sind?
Tics sind unwillkürliche Bewegungen oder Geräusche. Ich sage immer, man kann sich das vorstellen wie starken Juckreiz: Bei einem Tic entsteht der starke Reiz, etwas zu tun, und man kann es nicht oder nur sehr schwer unterdrücken. Eine andere gute Metapher ist Gähnen: Wenn wir uns mal bewusst beobachten, bemerken wir, wenn wir demnächst gähnen müssen. Der Drang kommt und wird immer stärker. Vielleicht gehen die Kiefer schon auseinander, aber wir pressen die Lippen zusammen, um den Mund nicht öffnen zu müssen. Aber irgendwann geben wir dem Reiz doch nach. Das veranschaulicht, wie schwer es ist, Tics nicht auszuleben – wobei sie noch viel schärfer und drängender sind als das Gähnen.
Tics sind also nicht kontrollierbar?
Zunächst nicht oder nur sehr kurz, und das erfordert sehr viel Kraft. Es ist wichtig, zu verstehen: Die betroffenen Kinder können nichts für ihre Tics. Sie führen sie nicht in der Absicht aus, andere zu ärgern oder zu nerven. Sie können einfach nicht anders.
Und wie kommt es zu diesem Verhalten?
Das Gehirn ist wie ein Orchester, und es gibt die Möglichkeit, Millionen von Tönen zu produzieren oder miteinander zu kombinieren. Bei einem Tic fehlt die Impulskontrolle und es ploppt einfach irgendeine dieser unzähligen möglichen Melodien auf. In bestimmten sozialen Situationen, zum Beispiel in der Schule, oder wenn die Melodie sehr häufig ertönt, wird das dann als unangemessen erlebt. Aber: Oft stört es die Betroffenen selbst gar nicht so sehr. Es ist häufig eher das Umfeld, das genervt reagiert. Dadurch kann dann auch bei den Kindern ein Leidensdruck entstehen.
„Ein Tic ist erst dann eine Störung, wenn er stört.“
Welche Beispiele für Tics gibt es?
Wir unterscheiden motorische und vokale Tics. Erstere sind Bewegungen, also zum Beispiel Blinzeln, mit den Fingern auf den Tisch klopfen, mit dem Kopf nicken, den Arm kreisen, mit den Schultern zucken. Vokale Tics sind Geräusche, Laute oder einzelne Wörter, die immer wieder geäußert werden. Räuspern ist der häufigste vokale Tic. Kommen mindestens zwei motorische und mindestens ein vokaler Tic zusammen und bestehen sie mindestens für ein Jahr, kann es sich um das Tourette-Syndrom handeln.
Diesbezüglich kennen viele das Beispiel mit den Schimpfwörtern in den unpassendsten Situationen.
Ja, das ist am bekanntesten, weil am meisten darüber berichtet wird. Wir nennen diese beleidigenden oder anstößigen Äußerungen Koprolalie. Die betrifft aber nur etwa zehn Prozent derer, die ein Tourette haben. Es gibt auch die Kopropraxie – das sind obszöne Gesten. Wir hatten mal einen Patienten, dessen anstößige Geste war im Ausland, in einer anderen Kultur, plötzlich kein Problem mehr. Also hat sein Gehirn sich eine neue gesucht, die in dem anderen Land wieder sozial unangemessen war. Letztlich laufen dabei unwillkürliche neurologische Prozesse ab, die gesellschaftliche Normen und Tabus in den Mittelpunkt rücken. Es gibt eine Art Hyperfokussierung auf die unerwünschte Handlung und dieser Prozess verstärkt sich selbst. Es gibt dabei auch eine starke genetische Komponente.
Gehen Tics mit anderen Störungen einher?
Häufig treten Ticstörungen zusammen mit anderen Diagnosen auf, beispielsweise mit ADHS oder Zwängen. Zwangs- und Ticstörungen können leicht verwechselt werden, hier muss man genau differenzieren. Während Tics ja keinen Zweck haben und einfach ausgeführt werden müssen, erfolgen Zwangshandlungen deshalb, weil Betroffene Angst vor Konsequenzen haben – dass sie krank werden, wenn sie sich nicht ständig die Hände waschen, oder dass jemand einbricht, wenn sie nicht regelmäßig die Haustür kontrollieren. Auch Ängste oder Depressionen können sich begleitend zu Tics entwickeln – weil es eben wiederholt Schwierigkeiten in sozialen Konstellationen gibt, die Kinder oder Jugendlichen immer wieder negative Erfahrungen machen und sich auch irgendwann zurückziehen. Der Ausschluss aus einer Gruppe ist für Heranwachsende die Höchststrafe. Hier ist es unsere große Aufgabe, das emotional aufzufangen und therapeutisch zu bearbeiten.
Wie können Sie Betroffenen in der Kinderpsychiatrie konkret helfen?
In der Behandlung einer Ticstörung gibt es drei Schritte. Der erste ist immer die Psychoedukation: Wir informieren das Kind, die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer darüber, was es heißt, eine Ticstörung zu haben, was dem Betroffenen hilft, wie das Umfeld im besten Fall reagiert. Stufe zwei ist die Psychotherapie, vorrangig die Verhaltenstherapie. Die bekommen bei uns alle Kinder ab dem späten Grundschulalter. Hier geht es zum Beispiel darum, Protokoll zu führen, um zu sehen, wie oft die Tics tatsächlich auftreten. Die Patientinnen und Patienten lernen in der Therapie, den sich anbahnenden Reiz frühzeitig bewusst wahrzunehmen, um dann die Intensität und Häufigkeit der Tics zu kontrollieren. Wir üben mit den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel ein alternatives Verhalten ein.
Wie sieht das konkret aus?
Wir hatten mal einen Patienten, der den Tic hatte, anderen permanent den Mittelfinger zu zeigen. Das ist natürlich einer Lehrerin gegenüber ungünstig. Zu dieser Zeit war der Rennfahrer Sebastian Vettel beliebt, der als Sieger-Geste immer seinen Zeigefinger hob. Wir haben dann mit dem Patienten geübt, statt des Stinkefingers den Vettel-Finger zu zeigen. Zusätzlich dazu lernen die Kinder und Jugendlichen verschiedene kleine Verhaltenstricks, sogenannte „Skills“, mit denen sie sich gut managen und einen völligen Kontrollverlust abfangen können. Wenn die Spannung groß wird, stehen sie kurz auf, drücken einen Stressball oder atmen tief ein – das ist ganz individuell. Auch die Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen sollten unbedingt wissen, was dem Kind hilft, sich zu regulieren. Noch mal ganz klar: Ein Tic ist erst dann eine behandlungsbedürftige Störung, wenn er stört – und zwar den betroffenen Menschen oder sein Umfeld. Es kann zum Beispiel auch sein, dass permanente unwillkürliche Bewegungen zu Schmerzen führen oder das Kind in der Schule stark ablenken. Es ist aber so, dass fast alle Tics im Lauf der Kindheit und Jugend weniger werden oder ganz weggehen.
Und was wäre die dritte und letzte Therapiestufe?
Die nutzen wir nur sehr selten, wenn die Tics sehr stark und beeinträchtigend sind: Medikamente. Die machen toleranter gegenüber dem Drang, den Tic umzusetzen, und zögern ihn so hinaus. Das Kind entscheidet selbst, ob ein Medikament bei ihm wirkt und wie es sich damit fühlt. Gibt es Nebenwirkungen, die er oder sie nicht möchte – zum Beispiel Müdigkeit? Ziel ist es immer, die Dosis nach und nach wieder abzusenken und irgendwann ganz auszuschleichen.
Ein Jugendlicher mit Tics erzählt
Der 14-jährige Tom (Name geändert) ist Patient der Tagesklinik der Kinderpsychiatrie des Uniklinikums Erlangen. „Ich hatte schon sehr viele Tics, ich erinnere mich gar nicht mehr an alle“, berichtet er. Beim Gehen musste er zeitweise einen Fuß an den anderen schlagen, immer wieder dieselben Wörter sagen, am Esstisch mit dem Stuhl vor und zurück rutschen, sich schütteln, kratzen oder den Kopf nach vorn kippen. „So mit elf, zwölf Jahren war es am schlimmsten“, erinnert sich Tom, der auch ADHS und eine Zwangsstörung hat. „In der Schule haben mich die Tics sehr gestört. Ich finde, die Lehrer müssen von den Therapeuten über die Tics informiert werden, damit sie sie verstehen. Mir würde es zum Beispiel schon helfen, wenn ich im Unterricht kurz aufstehen oder in den Nebenraum gehen dürfte. Was auch hilft, ist, wenn ich etwas trinke, weil der Tic eher hochkommt, wenn ich einen trockenen Hals habe. Auch gut ist, mir das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen.“ Lehrkräfte sollten Toms Meinung nach mehr eingreifen, wenn Schülerinnen oder Schüler wegen ihrer Tics gehänselt werden. Mit Psychologinnen und Ärzten zu sprechen, habe Tom gutgetan. „Es ist besser, mal mit anderen Personen darüber zu reden als mit den Eltern“, findet er. Nach einer weniger schönen Therapieerfahrung in einer anderen Klinik ist er jetzt zufrieden. „Hier geht es mir super“, sagt er über die Erlanger Tagesklinik, in die er seit zwei Monaten von Montag bis Freitag kommt. Nachmittags und an den Wochenenden kann er nach Hause. „Anderen Jugendlichen mit Tics würde ich raten, nicht die Motivation zu verlieren, ihre Skills (s. S. 43) zu nutzen und auch daran zu glauben, dass die Tics irgendwann wieder aufhören.“
Videobeitrag:
Ticstörungen bei Kindern und Jugendlichen
Weitere Informationen:
Kinderpsychiatrie
09131 85-39123
kontakt.kjp(at)uk-erlangen.de
Text: Franziska Männel/Uniklinikum Erlangen; Fotos: Franziska Männel/Uniklinikum Erlangen, generiert mit Midjourney von Franziska Männel/Uniklinikum Erlangen; zuerst erschienen in: Magazin „Gesundheit erlangen“, Frühling 2025