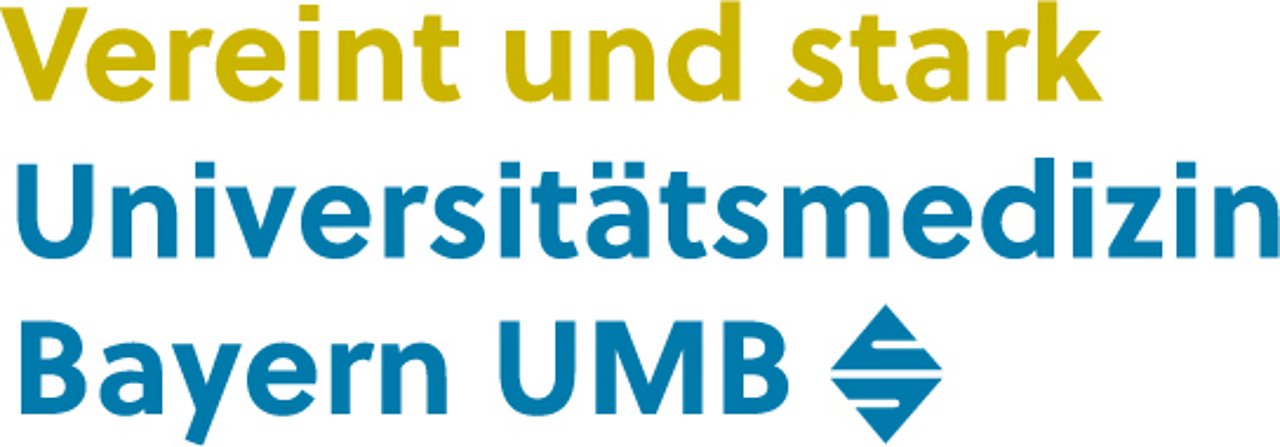„Skinny girl mindset“ ist die Lebensphilosophie, „legging legs“ sind das Ziel. Auf TikTok und Instagram glorifizieren Influencerinnen und Influencer unter dem Hastag #SkinnyTok ein ungesundes Schlankheitsideal. Doch der Trend ist gefährlich: Er begünstigt die Entstehung von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen.
Frau Dr. Stonawski, wie hat sich die Anzahl der an einer Essstörung erkrankten Kinder und Jugendlichen zuletzt entwickelt?
In der Coronapandemie haben wir eine deutliche Zunahme der Zahlen verzeichnen müssen, insbesondere bei der Magersucht. Leider sind wir noch nicht zum Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt. Die Kinder und Jugendlichen werden außerdem immer jünger: Es sind inzwischen bereits Elf- oder Zwölfjährige betroffen – meist von Magersucht. Das ist besorgniserregend.
Sind nach wie vor mehr Mädchen als Jungen betroffen?
Ja. Wir dürfen aber nicht vergessen: Auch Jungs sind betroffen! Allerdings äußern sich Essstörungen bei ihnen häufig anders. Sie streben meist eher nach einem vermeintlich gesunden, trainierten Körper. Dadurch bleibt die Erkrankung oft unerkannt.
Vor einigen Monaten ging der Hashtag #SkinnyTok auf TikTok viral. Darunter sind Videos zu finden, in denen meist junge Frauen zum Abnehmen aufrufen. Welchen Einfluss haben solche Trends auf die Entstehung von Essstörungen?
Wir alle werden durch unser Umfeld sozialisiert – und dabei spielen heute gerade bei Kindern und Jugendlichen soziale Medien wie TikTok oder Instagram eine große Rolle. Sie verbringen dort viel Zeit – oft mehrere Stunden täglich – und werden ständig mit bestimmten Schönheitsidealen konfrontiert. Das kann durchaus einen großen Einfluss auf das Körperbild und die Selbstwahrnehmung haben. Auch deshalb, weil viele der Kinder und Jugendlichen eine emotionale Bindung zu den Influencerinnen und Influencern aufgebaut haben. Inwiefern? Unsere Patientinnen und Patienten beschreiben häufig, dass sie das Gefühl haben, die Content-Creator zu „kennen“ – fast wie eine Freundin oder einen Freund. Schließlich verbringen sie online viel Zeit mit der Person beziehungsweise den Inhalten, die diese auf den Plattformen teilt. Dadurch entsteht eine gewisse emotionale Nähe. Studien zeigen, dass sich Menschen oft mit ihren Idolen identifizieren und deren Werte und Einstellungen übernehmen – beispielsweise das Schönheitsideal, das Ess- oder Sportverhalten. Das Problem: Verglichen mit der vermeintlich perfekten Welt auf Social Media fällt das Urteil über das eigene Leben oder die eigene Figur meist negativ aus.
Wenn beinahe alle Kinder und Jugendlichen in sozialen Medien aktiv sind – warum entwickeln manche eine Essstörung und andere nicht?
Die Vulnerabilität – also die Anfälligkeit – der Kinder und Jugendlichen variiert, je nachdem, welche individuellen Erfahrungen sie mitbringen. Auch die aktuelle Lebenssituation ist ausschlaggebend: Hat das Kind ein stabiles soziales Umfeld im realen Leben? Wichtig ist: Schönheitsideale auf Social Media können ein Risikofaktor sein – sie sind aber nie die alleinige Ursache für eine Essstörung.
Welche möglichen Ursachen gibt es noch?
Essstörungen sind komplexe Erkrankungen – es gibt in der Regel nicht die eine Ursache. Neben dem Schönheitsideal, das in der Gesellschaft und in den sozialen Medien vermittelt wird, spielen auch biologische Faktoren, etwa die Genetik und der Stoffwechsel, eine Rolle. Ebenso können bestimmte Persönlichkeitsmerkmale die Entstehung des Störungsbilds begünstigen, etwa ein niedriger Selbstwert, Perfektionismus und Leistungsorientierung. Kommt dann noch ein belastendes Ereignis hinzu, beispielsweise die Trennung der Eltern oder eben die Pandemie, kann dies eine Essstörung auslösen. Die Pubertät ist ohnehin eine sensible Phase im Leben eines Kindes – Aussehen und Figur spielen eine immer größere Rolle. Jugendliche machen sich viele Gedanken darüber, wie sie bei anderen ankommen – das erhöht die Anfälligkeit.
Es gibt neben den verschiedenen Faktoren, die eine Essstörung begünstigen, also meist einen konkreten Auslöser?
Häufig schon. Die Essstörung ist eine Strategie der Psyche, um auf ein problematisches Ereignis zu reagieren. Gerade Binge-Eating und Bulimie dienen häufig der Emotionsregulation; Betroffene essen übermäßig, um ihre eigentlichen Gefühle nicht spüren zu müssen. Doch auch die Stabilisierung des Selbstwerts über kontrolliertes Essen oder einen schlanken Körper kann eine Rolle spielen. Grundsätzlich „möchte“ die Essstörung den Kindern und Jugendlichen helfen, bestimmte Probleme zu lösen. Doch dieser Lösungsversuch ist offensichtlich dysfunktional.
Wie können Essstörungen behandelt werden?
Es gibt drei zentrale Säulen. Zum einen ist es das Ziel, das Essverhalten zu normalisieren: Die Kinder und Jugendlichen müssen erst wieder lernen, „normal“ zu essen, was eine angemessene Portion ist und dass bestimmte Lebensmittel nicht gefährlich sind. Bei Magersucht ist auch eine Gewichtsstabilisierung nötig. Hinzukommt die klassische Psychotherapie: In Einzel- und Gruppensitzungen erarbeiten wir mit den Patientinnen und Patienten ein Erklärungsmodell, um zu verstehen, welche Ursachen die Erkrankung hat. Anschließend bearbeiten wir die zugrunde liegenden Probleme und entwickeln gemeinsam gesunde Verhaltensstrategien, die die Jugendlichen anstelle der Essstörung nutzen können. Drittens ist es wichtig, die Eltern einzubeziehen. Für viele von ihnen ist die Erkrankung des Kindes sehr belastend. Die Eltern werden darin unterstützt, die Situation zu verstehen und ihr Kind zu begleiten.
Wie lange dauert die Behandlung?
Essstörungen sind ernste Erkrankungen. Die Behandlung kann – je nach Schweregrad – ambulant, teilstationär oder stationär erfolgen. Sie nimmt je nach Setting meist mehrere Monate oder Jahre in Anspruch.
Welche Rolle spielt der Einfluss von Social Media in der Therapie?
Wir greifen das Thema beispielsweise in der Gruppentherapie auf. Dort können die Jugendlichen sich austauschen und lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen. Wir versuchen, die Medienkompetenz zu stärken, schauen uns gemeinsam Profile an, sprechen über Beauty-Filter, Photoshop, KI und die emotionale Wirkung solcher Beiträge. Viele wissen zwar, dass ihnen bestimmte Inhalte nicht guttun – trotzdem fällt es ihnen schwer, sich davon abzugrenzen oder den Accounts zu entfolgen. Die emotionale Bindung ist zu stark.
Können Inhalte in den sozialen Medien auch einen positiven Einfluss haben?
Es gibt Hinweise, dass Recovery-Accounts, also solche, auf denen Betroffene ihren Heilungsweg teilen, motivierend wirken können. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: Manchmal verschieben sich Probleme einfach – etwa von der Essstörung hin zu exzessivem Sport. Deshalb ist ein kritischer Blick immer notwendig.
Welche Wirkung hätte ein vielfältigeres Körperbild auf Social Media?
Die Präsenz unterschiedlichster Körperformen in den sozialen Medien könnte durchaus einen positiven Einfluss auf das Körperbild der Kinder und Jugendlichen haben. Es gibt in den sozialen Medien auch bereits Trends, etwa die Body-Positivity-Bewegung, die sich für die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale einsetzen. Das Problem ist jedoch, dass die Algorithmen der Plattformen darauf ausgerichtet sind, den Nutzerinnen und Nutzern immer extremere Inhalte anzuzeigen. Es ist daher sehr schwer, einen diversen Feed zu bekommen – selbst wenn diese Inhalte existieren.
Was können Eltern, Freundinnen oder Freunde tun, um Betroffenen zu helfen?
Im Umgang mit Social Media empfehlen wir den Eltern, nichts zu verbieten, sondern offen und interessiert zu sein. Mütter und Väter sollten nachfragen, was ihre Kinder online sehen – und bei problematischen Inhalten gemeinsam ins Gespräch kommen. Generell gilt: Hinschauen, ehrlich sein und die eigene Sorge aussprechen! Wichtig ist, Verständnis zu zeigen und dem Kind zu vermitteln: „Ich bin für dich da – und gegen die Essstörung.“ Und: Den Selbstwert des Kindes stärken und ihm verdeutlichen, dass es mehr ist als sein Körper. Letztlich empfehle ich aber, professionelle Hilfe hinzuzuholen – etwa über die Kinderärztin oder den Kinderarzt, Beratungsstellen oder Praxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder -psychotherapie. Je früher die Behandlung erfolgt, desto besser die Heilungschancen.
Wie äußert sich eine Essstörung?
Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Binge- Eating äußern sich durch auffällige Veränderungen im Essverhalten. Dieses spielt gemeinsam mit dem Körpergewicht im Leben der Betroffenen eine immer größer werdende Rolle. Bei Magersucht essen Betroffene extrem eingeschränkt und verlieren dadurch massiv an Gewicht – meist bis hin zum starken Untergewicht. Häufig treiben sie zusätzlich sehr viel Sport und leiden unter einer gestörten Körperwahrnehmung: Sie empfinden sich trotz Untergewicht als zu dick. Menschen mit Bulimie streben ebenfalls ein niedriges Gewicht an, erleben aber wiederkehrende Essanfälle, bei denen sie große Mengen an Nahrung zu sich nehmen. Um eine Gewichtszunahme zu verhindern, erbrechen sie danach oder kompensieren mit exzessivem Sport. Auch bei der Binge-Eating-Störung kommt es zu solchen Essanfällen, allerdings ohne Gegenmaßnahmen – oft führt das zu Übergewicht.
61 von 1.000
Von 1.000 Mädchen und Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 28 an einer Binge-Eating-Störung, 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Bei Männern und Jungen sind Essstörungen deutlich seltener, aber auch sie sind zunehmend betroffen – oft unerkannt.
Verbotener Trend
Seit Juni 2025 ist der Begriff #SkinnyTok zum Schutz von Kindern und Jugendlichen auf TikTok gesperrt – doch die Inhalte sind weiterhin da; sie tauchen nun unter anderen Hashtags auf.
Bürgervorlesung
Am Montag, 12. Januar 2026, laden Dr. Valeska Stonawski und Prof. Dr. Oliver Kratz, kommissarischer Leiter der Erlanger Kinderpsychiatrie, zur Bürgervorlesung „Wenn die Seele hungert – Diagnostik und Behandlung der Magersucht bei Jugendlichen“ ein (18.15 Uhr, Hörsäle Medizin, Ulmenweg 18 in Erlangen). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.