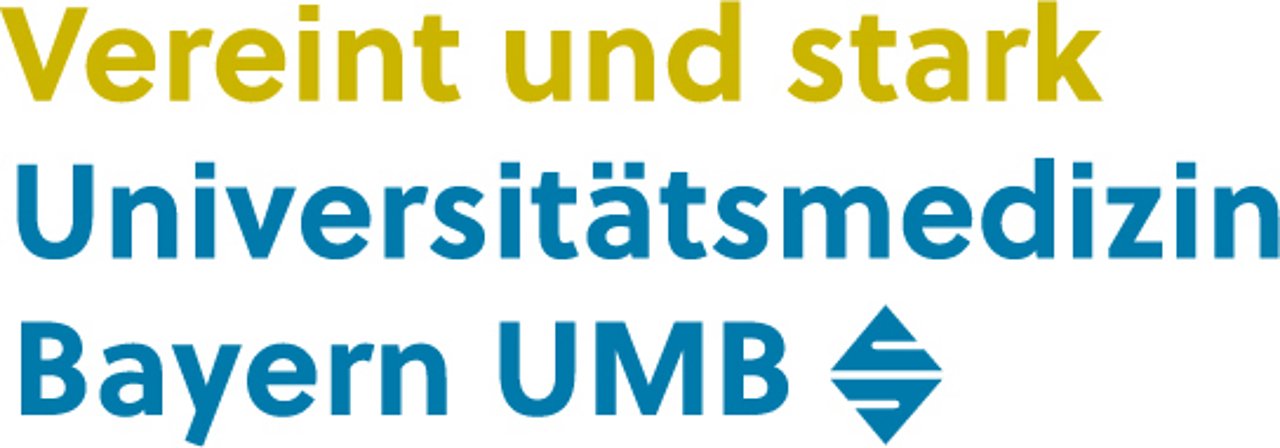Nach einer Epilepsie-Operation, einer Tumorentfernung im Kopf oder einer Not-OP aufgrund eines Aneurysmas kommen Patientinnen und Patienten auf die Neuro-Intensivstation. Hier werden sie mit besonders großer Fürsorge gepflegt. Die Angehörigen dürfen sich dabei gezielt mit einbringen. Ein Besuch.

„Mein eigenes Gehirn hat mich fast umgebracht – aber ich habe gewonnen.“ Das steht auf Englisch auf dem T-Shirt von Andreas R. Seine Familie hat es für ihn bedrucken und das Team der Neuro-Intensivstation des Uniklinikums Erlangen darauf unterschreiben lassen. Für die Zeit nach dem Krankenhaus. Jetzt, im Juni 2024, liegt der 29-Jährige noch in seinem Bett, angeschlossen an die Beatmungsmaschine und umgeben von piependen Monitoren, Schläuchen und einem fahrbaren Ständer, der mit verschiedenen Schmerz- und Infusionspumpen bestückt ist. Seit knapp zwei Wochen liegt er hier, wurde ins künstliche Koma versetzt. „Damit sein Gehirn sich erholen kann“, sagt seine jüngere Schwester Jasmin R. Es ist 15.30 Uhr und trubelig in dem Vierbettzimmer, denn auch die anderen Patientinnen und Patienten haben Besuch, die Pflegekräfte laufen von hier nach da und dann ist da noch das Redaktionsteam. „Andreas war gerade unterwegs zu einer Freundin. Er rief mich auf einem Parkplatz an und sagte, ich solle sofort zu ihm kommen, weil es ihm nicht gut geht“, berichtet seine Mutter Kornelia R. Als sie schließlich bei ihm war, lag ihr Sohn bereits im Rettungswagen, ein Mundwinkel hing nach unten. Die Ärztinnen und Ärzte in der Notaufnahme der Erlanger Kopfkliniken bestätigten den Verdacht auf Schlaganfall. Ausgelöst wurde er durch eine Sinusvenenthrombose, also ein Gerinnsel im Gehirn. Die Nacht verbrachte der Industriemeister auf der Stroke-Unit, einer Station speziell für Schlaganfälle; eine baldige Entlassung war geplant. „Wir waren guter Dinge, dass Andreas mit einem blauen Auge davonkommt. Aber dann musste er notoperiert werden, weil sein Hirndruck so hoch war, dass es zu Blutungen im Gehirn kam“, schildert Kornelia R. „Seitdem liegt er auf der Neuro-Intensivstation.“

Der junge Mann, der wohl seit seiner Geburt an einer Gerinnungsstörung leidet, die die Thrombose ausgelöst hat, bekommt täglich Besuch. „Es geht einem natürlich schon ans Herz, das eigene Kind so zu sehen, die eigenen Kräfte lassen irgendwann nach“, berichtet Kornelia R. Das Team der Neuro-Intensivstation reduziert aktuell nach und nach die Sedierung von Andreas R., denn er ist stabil und soll in einigen Tagen aufwachen. „Manchmal bewegt er schon seine Hände oder öffnet ganz kurz die Augen“, sagt Jasmin R., und es ist spürbar, wie stolz sie auf die Fortschritte ihres Bruders ist. Erwartet hatte die 27-Jährige, dass sie die Intensivstation nur mit Mundschutz und Haube betreten darf. „Aber alles ist hier so offen, man hat fast das Gefühl, das ist eine normale Station – bis auf das Piepsen, die Monitore und die Schläuche vielleicht.“ Mama Kornelia ergänzt: „Das Team ist spitze. Alle haben sich viel Zeit genommen und jedes Detail erklärt, Pflege, Ärztinnen und Ärzte. Wir dürfen Musik mitbringen, ihm vorlesen, ihn sein Parfüm riechen lassen. Auch besuchen können wir Andreas, wann immer wir wollen. Das ist sehr hilfreich für uns.“

Angehörige dürfen mitpflegen
Der Duft von ätherischem Öl zieht durch das Patientenzimmer. Jasmin R. massiert ihrem Bruder die Füße, während Mama Kornelia seine Hand drückt und leise mit ihm spricht. Dass Angehörige bei verschiedenen Pflegetätigkeiten – etwa beim Rasieren oder Kämmen – mithelfen dürfen, wenn sie das möchten, ist ein Element des Konzepts „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ (s. Kasten), das in Erlangen aktiv gelebt wird. „Ich finde diese Möglichkeit total gut“, sagt Jasmin R. „Dadurch hat man das Gefühl, etwas Sinnvolles beitragen zu können.“ So hat sie bei ihrem Bruder beispielsweise schon einmal Fieber gemessen, ihre Mutter cremt Andreas R. regelmäßig ein und hilft beim Umlagern. Ganz besonders schätzen die beiden Frauen die offene Kommunikation: „Das Team spricht einem Mut zu, ohne zu viel Fortschritt zu versprechen“, merkt Kornelia R. an, und ihre Tochter ergänzt: „Nach jedem Besuch gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause, weil ich weiß, Andi ist hier gut aufgehoben.“ Auch dass das Stationsteam sie regelmäßig zu einem fest vereinbarten Termin anruft, um etwa zu berichten, wie sich Andreas R.s Zustand über Nacht verändert hat, finden sie entlastend. Pflegefachkraft Jacqueline Mc Farland erklärt: „Die Angehörigen können sich darauf verlassen, dass wir uns melden. Wir nehmen uns die Zeit, um Antworten auf offene Fragen zu geben und auf individuelle Ängste und Wünsche einzugehen. Und dank der fest eingeplanten Telefonate lassen sich Unterbrechungen unseres Arbeitsflusses reduzieren, die sich sonst durch Anrufe der Angehörigen ergeben würden.“ Tagebuch für die Zeit danach Kornelia R. schlägt stolz das reichlich gefüllte Intensivtagebuch ihres Sohnes auf. Sowohl Angehörige als auch Pflegekräfte schreiben hier regelmäßig für „Superman Andi, der hier alle auf Trab hält und kämpft wie ein Löwe“, damit er später besser nachvollziehen kann, was passiert ist, während er im Koma lag. Fachkrankenschwester Lisa schrieb z. B. während einer Nachtschicht: „In Ihren Kopf wurde ein Schlauch gelegt, der dafür sorgt, dass Sie keinen Hirndruck entwickeln. Jede Stunde leuchte ich Ihnen in die Augen, um zu sehen, wie Ihre Pupillen aussehen und reagieren. Alle drei Stunden positioniere ich Sie neu im Bett, damit Sie nirgends Druckstellen bekommen.“ Für Angehörige ist das Tagebuch eine mentale Stütze und dokumentiert gute Wünsche: „30. Geburtstag, EM, London, … alles, was noch ansteht, wird ordentlich gefeiert. […] Bitte kümmer dich jetzt erst mal nur um dich. Alles, was Spaß macht, wird gemacht!“ lautet ein Eintrag. Ein anderer: „Wir alle denken an dich und geben dir Kraft, sodass wir diese Tage gemeinsam überstehen.“ Vorbei an einer grünen Trennwand voll mit Fotos des jungen Patienten mit Freunden und Familie läuft Jasmin R. zur Tür des Stationszimmers. „Der ganze Trubel hier. Andreas denkt bestimmt: ‚Die sind verrückt‘“, sagt sie lachend, dreht sich noch einmal um und bleibt mit offenem Mund stehen. Denn Andreas – es ist trotz Beatmungsschlauch zu erkennen – lächelt, öffnet die Augen und schaut Schwester und Mama für ein paar Sekunden forsch an. Dann dämmert er wieder weg. Jasmin R. strahlt: „Das haben wir bisher nicht erlebt, dass er einen gezielt ansieht. Das heißt wohl, dass er bald aufwacht.“

Intensive Betreuung
Tagsüber ist eine Pflegefachkraft für zwei Patientinnen bzw. Patienten zuständig, nachts für drei. „Wir haben hier Zwei- und Vierbettzimmer und zwei Isolationsräume für immunsupprimierte oder ansteckende Patienten“, erläutert Diana Hunsicker, die seit drei Jahren auf der Erlanger Neuro-Intensivstation arbeitet und insgesamt 15 Jahre Erfahrung in der Intensivmedizin mitbringt. Sie zeigt auf den „Baum“ neben sich, an dem Medikamenten- und Ernährungspumpen, Beatmungsgerät, Pulsoxymeter zur Messung der Sauerstoffsättigung, Absaugkatheter, Blutdruckmanschette, EKG und Monitore befestigt sind. „In Notfallsituationen müssen wir hier auf der Intensivstation besonders schnell reagieren, und es ist schon fordernd, wenn wir manche Menschen nur noch beim Sterben begleiten können. Gerade Ältere bekommen oft keinen Besuch. Die Einsamkeit dieser Patientinnen und Patienten geht mir manchmal schon nahe. Auch, wenn ich Menschen pflege, die in meinem Alter sind, nehme ich das ab und zu gedanklich mit nach Hause. Aber das Positive an meinem Job überwiegt. Ich finde es erfüllend, Fortschritte bei den Patientinnen und Patienten zu sehen und sie bei ihrer Genesung zu unterstützen.“

Tägliche Mobilisation
Aktiv an der Genesung beteiligt ist auch Physiotherapeutin Julia Keltsch. Sie steht am Bett von Sebastian Flotte*, der auf dem Weg zu einem Termin im Internistischen Zentrum des Uniklinikums Erlangen stürzte und eine Hirnblutung hatte. „Wir machen gleich ein paar Übungen für den Kreislauf und die Lunge. Dann schauen wir mal, ob Sie sich an die Bettkante setzen können“, kündigt Julia Keltsch an und fährt das Kopfteil des Bettes etwas hoch. Sie kreist die Fußgelenke ihres Patienten zunächst aktiv, dann führt er die Übung selbstständig aus. „Jetzt paddeln wir mal mit den Füßen“, leitet die Physiotherapeutin an, „und nun ziehen Sie sie mal Richtung Körper.“ Sebastian Flotte macht sich gut, die Physiotherapeutin ist zufrieden. Er legt nun seine rechte Hand auf den Bauch und atmet bewusst tief dorthin. „Spüren Sie, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt, und lassen Sie die Luft langsam über den Mund raus.“ Julia Keltsch will nun den verkrampften Schultergürtel ihres Patienten lockern: Sie streckt den Arm zur Decke, öffnet ihn dann zur Seite; der Patient macht es ihr nach. Die Therapeutin hilft Sebastian Flotte, sich an der Bettkante aufzurichten. Dann macht er im Sitzen einen kleinen Seitschritt und tritt auf der Stelle. „Gut gemacht, das reicht für heute“, resümiert sie lächelnd und ermahnt ihren Patienten, sich nicht zu schnell wieder hinzulegen. „Sonst wird Ihnen schwindelig.“
Geplant auf der Neuro-Intensivstation
Nicht alle Patientinnen und Patienten auf der Neuro-Intensivstation sind notfallmäßig hier; auch Menschen, die sich geplant einer Operation unterziehen, bei der der Schädel geöffnet wird – etwa zur Entfernung eines Hirntumors –, verbringen hier einige Tage. So auch Heidrun Hölz*, die unter einem Meningeom litt, einem meist gutartigen Tumor an der Schädelbasis. „Elektive Patientinnen wie sie werden einen Tag vor der OP von uns detailliert aufgeklärt. Wir bereiten sie darauf vor, dass sie zuerst auf der Intensivstation und kurz darauf auf der Normalstation liegen werden, sofern sich keine Komplikationen ergeben“, erklärt Jacqueline Mc Farland. Bei Heidrun Hölz wurde der Tumor erst erkannt, als sich ihre Gesichtsfeldeinschränkungen nach einem Eingriff wegen Grauem Star nicht verbesserten und ein MRT-Bild schließlich die Wucherung zeigte. „Das Meningeom hat auf den Sehnerv gedrückt. Jetzt, wo es weg ist, merke ich gleich eine Verbesserung“, schildert Heidrun Hölz zwei Tage nach der OP. „Die Betreuung hier ist sagenhaft. Ich glaube nicht, dass sie besser sein könnte. Ich werde stets super überwacht und sehr kompetent über alles informiert.“ Die 71-Jährige wird in einigen Tagen entlassen und freut sich schon auf ihr „Paradies“: den Garten, das Malen und darauf, ihre Kinder und Enkelkinder wiederzusehen. Bis dahin erinnert ein selbst gebasteltes Plakat an ihre Familie, rundherum liegen frische Zitronen aus Heidrun Hölz’ Garten. Sie duften nach zu Hause.
*Name von der Redaktion geändert
Angehörigenfreundliche Intensivstation
Das Team der Neuro-Intensivstation hat auf Grundlage der Guidelines zur Family Centered Care (familienorientierte Betreuung) ein ganzheitliches Angehörigenkonzeptimplementiert. So haben Angehörige z. B. flexible Besuchszeiten und gelten als ein wichtiger Teil der Therapie. Denn: Nach neuesten Erkenntnissen tragen Angehörige wesentlich zur Genesung bei. Zum Konzept gehört es u. a., proaktive Angehörigengespräche zu führen, Angehörige in pflegerische Maßnahmen einzubeziehen und Kindern den Besuch auf der Intensivstation zu ermöglichen. Dafür erhielt das Team das Zertifikat „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ vom Pflege e. V.
Physiotherapie auf der Neuro-Intensiv
Alle Patientinnen und Patienten erhalten täglich Physiotherapie – auch wenn sie es nicht mitbekommen, weil sie im Koma liegen. „Eine frühe Mobilisation ist wichtig, damit sich die Muskeln nicht abbauen und die Gelenke beweglich bleiben. Außerdem belüften die Übungen die Lunge, stabilisieren den Kreislauf und beugen einer Thrombose vor“, zählt Julia Keltsch auf. „Ich gehe auf die individuellen Bedürfnisse und Vorerkrankungen ein und sehe häufig recht zügig Fortschritte.“
Innovative Ansätze
Stationsleitung Markus Prinz setzt sich regelmäßig für innovative Projekte auf der Neuro-Intensivstation ein: So soll ein spezielles Lichtkonzept beatmete Patientinnen und Patienten vor einem postoperativen Delir bewahren. Die LED-Paneele ahmen den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus nach, unterschiedliche Lichtfarben sollen z. B. Unruhezuständen entgegenwirken. Ein weiterer Ansatz betrifft das Weaning. Bei dieser Entwöhnung von der Beatmungsmaschine werden Komapatientinnen und -patienten per Kopfhörer von den Stimmen ihrer Angehörigen begleitet. Die Betroffenen finden so deutlich schneller zur natürlichen Atmung zurück.
Mit dem Laden des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Video: Ein Besuch auf der Neuro-Intensivstation
Text und Fotos: Alessa Sailer/Uniklinikum Erlangen; zuerst erschienen in: Magazin „Gesundheit erlangen“, Herbst 2024