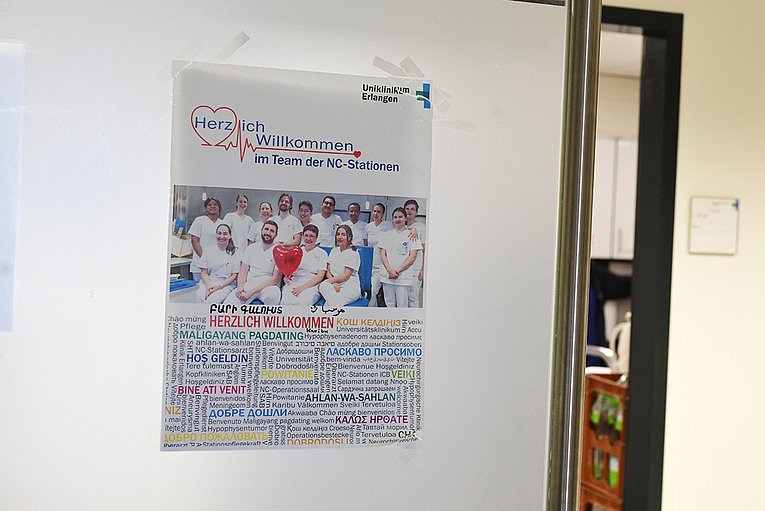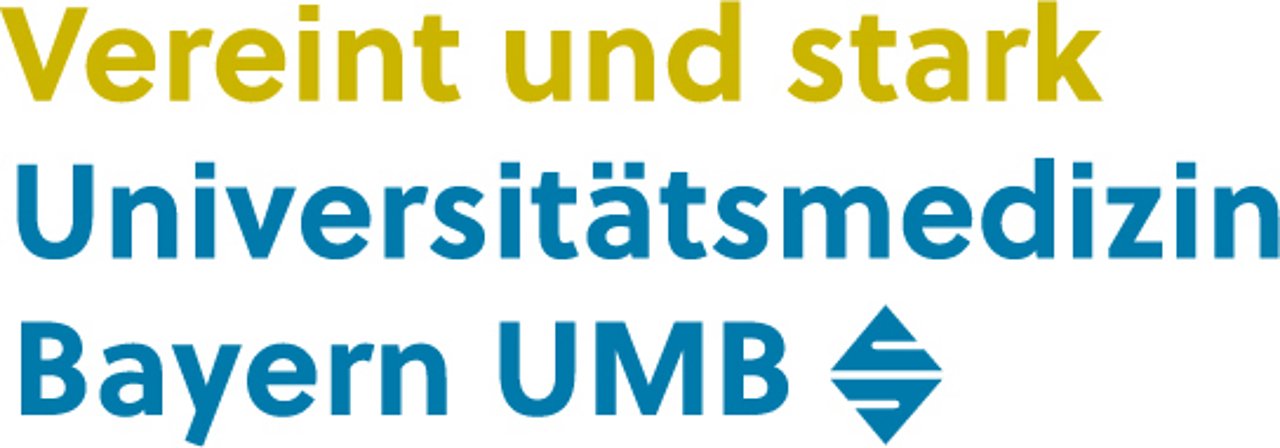Unterschiede wahrnehmen, Gemeinsamkeiten finden und wegkommen von „richtig“ und „falsch“: Das tun die Mitarbeitenden kultursensibler Krankenhäuser. Warum es sich lohnt, den Weg der Integration zu gehen – und wie er gelingen kann. Ein Bericht aus dem Uniklinikum Erlangen.
„Ich nehme die Menschen, wie sie sind. Anders kriege ich sie nicht“, sagt Marc Reinhold. Der Gesundheits- und Krankenpfleger in der Neurochirurgischen Klinik des Uniklinikums Erlangen hat im Lauf eines Jahres 17 neue internationale Kolleginnen und Kollegen bekommen – u. a. von den Philippinen, aus Indien, Tunesien, Serbien und Somalia. Sie verteilen sich auf die neurochirurgischen Normalstationen 32 und 22 sowie die Privatstation 31. „Die Zusammenarbeit klappt gut“, findet Marc Reinhold. Kürzlich hat er gemeinsam mit anderen Pflegefachkräften des Uniklinikums Erlangen ein Seminar zur interkulturellen Teamentwicklung besucht. Seine Motivation: „Ich möchte wissen, was ich noch nicht weiß. Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, indem ich Fehler mache, die vermeidbar wären“, erklärt er. Das gelte für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Patientinnen und Patienten mit anderem kulturellen Hintergrund.
Welt-Schmerz
Marc Reinholds Team versorgt Menschen u. a. nach Schädel-, Hirn- oder Rückenmarksverletzungen sowie nach Operationen an Gehirn oder Wirbelsäule. Dass solche Patientinnen und Patienten Schmerzen äußern oder Angehörige mitunter schlechte Nachrichten verarbeiten müssen, ist für die Mitarbeitenden der Neurochirurgie nicht ungewöhnlich. „Gerade Schmerzen und auch Trauer werden kulturell aber ganz unterschiedlich ausgedrückt“, erklärt Silke Ettling, Expertin für interkulturelle Kommunikation im Gesundheitswesen. Sie leitete den Workshop, an dem auch Marc Reinhold teilnahm. Werden körperliche Beschwerden in Deutschland tendenziell gefasst kommuniziert, so geschieht das in anderen Kulturen mitunter noch weniger emotional, aber manchmal auch deutlich gefühlsbetonter. Ärztliches und pflegerisches Personal hat bei Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund dann die Aufgabe, gesteigerte Emotionalität nicht als Hysterie abzutun, sondern als kulturelle Eigenheit zu erkennen und körperliche Ursachen dennoch gründlich zu erforschen. Auch bei der Trauerbewältigung gibt es Unterschiede: Für deutsche Angehörige ist es normal, sich gegenüber einer Ärztin noch zu beherrschen, bevor sie später emotional zusammenbrechen. Bei Menschen anderer Kulturen kann es passieren, dass sie Trauer oder Verzweiflung schon im Krankenhaus viel stärker nach außen tragen – etwa in Südosteuropa oder im Nahen Osten. „Ich erinnere mich an eine Patientenfamilie aus dem Balkan“, berichtet Marc Reinhold. „Mehrere Personen kamen zu uns auf Station. Sie hatten einen richtigen Trauerausbruch, rissen die Arme hoch, stöhnten und waren einfach sehr laut. Ich fand das total eindrücklich.“
„Kultur ist ein ungeschriebenes, unbewusstes Regelwerk, das unser Denken, Fühlen und Handeln lenkt. Wir denken darüber nicht mehr nach – es ist unsere Normalität.“
Das Wir und das Ich
Die Workshopleiterin ordnet ein: „Für den Großteil der Weltbevölkerung hat die Gemeinschaft einen viel höheren Stellenwert als bei uns. In diesen kollektivistischen, beziehungsorientierten Gesellschaften ist es üblich, im Krankenhaus von vielen Menschen gleichzeitig besucht zu werden. Man möchte der kranken Person Zuwendung und menschliche Wärme schenken – allein kann sie, aus Sicht vieler Kulturen, nicht gesund werden.“ Völlig anders die deutsche Perspektive: Hier sollen Kranke Ruhe bekommen und lieber weniger Besuch als zu viel. „Andersherum fragt man sich hier, wie sich jemand bei so einem Trubel erholen soll“, so die Expertin. Und was, wenn beide Überzeugungen am Krankenbett kollidieren? „In Einzelzimmern lassen wir große Gruppen zu“, erklärt Pflegefachkraft Marc Reinhold. „In Zweibettzimmern begrenzen wir es auf zwei Besuchende pro Patient. Dafür dürfen sie abends aber auch mal zwei Stunden länger bleiben als üblich.“ Die Lösung einer anderen Teilnehmerin des interkulturellen Seminars: Wenn eine Patientin schon mobil ist, könne man sie auch bitten, sich mit ihren Angehörigen in die Sitzecke der Station zu setzen – so habe sie Gesellschaft und die deutsche Patientin im Zimmer ihre Ruhe. „Das wird beiden gerecht, das ist kultursensibel“, urteilt Silke Ettling.
Die direkten Deutschen
Empathie ist in interkulturellen Kontexten auch dann gefragt, wenn es um deutliche Meinungsäußerungen geht. Unverblümte Kritik ist etwa in Südostasien sehr unüblich, ebenso direktes Neinsagen. Die Menschen dort versuchen tendenziell, Konflikte zu vermeiden – niemand soll bloßgestellt oder enttäuscht werden. „Ich musste erst lernen, dass ich in Deutschland offen und direkt kommunizieren soll“, erklärt die Philippinerin Margarette Bernales, die im Herbst 2023 als Pflegefachkraft auf der neurochirurgischen Station 32 begann. „Anfangs war ich sehr schüchtern, wollte nichts falsch machen und musste erst mal Selbstvertrauen aufbauen“, gesteht sie. Marc Reinhold erklärt: „Immer wieder ermuntere ich unsere zugewanderten Kolleginnen und Kollegen, mich anzusprechen, wenn sie Fragen haben. Ich nehme sie immer ernst, erkläre alles sehr ruhig und langsam. Und ich mache ihnen klar, dass es hier etwas Gutes ist, wenn man aktiv nachfragt und Feedback gibt. Ich weiß aber auch, dass das anfangs schwierig ist und vielleicht erst ein paar Mal Ja gesagt wird, obwohl Nein gemeint ist.“ Nach und nach wuchs Margarette Bernales’ Vertrauen, sodass sie heute „frei und ehrlich“ spricht, wie sie sagt.
Mach (nicht) dein Ding!
Neben dem direkten Kommunizieren geht es an deutschen Arbeitsplätzen oft auch um Selbstständigkeit. Wer hier beruflich ankommen möchte, sollte zuverlässig und vor allem eigenverantwortlich arbeiten. Was jedoch in Deutschland als hoher Wert gilt, ist in anderen Teilen der Welt gar nicht erstrebenswert. „In Asien einfach sein eigenes Ding zu machen, ist weniger gern gesehen“, weiß Silke Ettling. „Dort erwartet man Anweisungen von jemandem, der eine Hierarchieebene höher steht“, erklärt die Ethnologin, die von längeren Reisen und Forschungsaufenthalten im Ausland einen großen Erfahrungsschatz mitgebracht hat. Geduld und fortwährendes Ermutigen der „Neuen“ sei die beste Strategie, denn Kultur sei tief verankert und Verhalten verändere sich nicht von heute auf morgen.
Mit Worten und Blicken
„Auch wir lernen von den internationalen Pflegefachkräften“, berichtet Marc Reinhold und hebt hervor: „Sie haben ein enormes Fachwissen, egal ob in Anatomie, Pharmakologie oder Therapie. Sie haben alle studiert, in Deutschland machen wir stattdessen eine Berufsausbildung. Wir arbeiten dafür sehr nah am Patienten, waschen, beobachten, lagern und mobilisieren, wechseln Verbände – das machen in vielen anderen Ländern die Angehörigen.“ Es ist spürbar, dass das Team der Station 32 einen angstfreien, offenen Raum geschaffen hat, in dem neue Mitarbeitende ganz allmählich ankommen können. Natürlich sei die Sprache, vor allem das Fränkische, anfangs herausfordernd. Und „Hock dich hi“ steht nun mal in keinem Wörterbuch. Gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für eine Einstellung am Uniklinikum Erlangen. Dazu bekommen alle ausländischen Pflegefachkräfte einen vierwöchigen Intensiv-Sprachkurs, bevor sie überhaupt auf Station anfangen. Danach geht das Deutschlernen berufsbegleitend weiter. Doch auch Mimik und Gestik können interkulturelle Hürden sein. So erlebte es auch Shency Mol Baby aus Indien, die seit Sommer 2024 auf Station 32 arbeitet. Marc Reinhold im Gespräch in die Augen zu sehen, war für die 35-Jährige anfangs schwer. „In Indien tun wir das nicht – aus Respekt, gerade vor Vorgesetzten“, erklärt sie. In Deutschland gilt es wiederum als unhöflich, jemanden beim Sprechen nicht anzuschauen. Erlebt man Shency Mol Baby heute, neun Monate nach ihrem Start in Europa, glaubt man kaum, dass ihr der Blickkontakt einmal schwerfiel. Dass Deutsche krankenversichert sind und dass hier grundsätzlich alle behandelt werden – egal, wie viel Geld sie haben –, findet die junge Frau toll, denn in ihrer Heimat kann nur versorgt werden, wer es sich leisten kann.
„Wir brauchen die Zuwanderung von Fachkräften unbedingt – ohne sie geht es nicht.“
Ein Leben in zwei Koffern
„Wir brauchen die Zuwanderung von Fachkräften unbedingt – ohne sie geht es nicht“, betont Tanja Hofmann, stellvertretende Pflegedirektorin des Uniklinikums Erlangen. „Unsere neurochirurgischen Stationen beispielsweise setzen deren Integration vorbildlich um.“ Laut Tanja Hofmann bleibt die internationale Pflege-Akquise weiterhin wichtiger Baustein der Personalgewinnung des Uniklinikums Erlangen, denn „der lokale Arbeitsmarkt ist leer und allein mit den Azubis unserer eigenen Pflegeschule decken wir unseren Bedarf nicht“, erläutert sie. Lena Kellner, Referentin der Pflegedirektion, gibt den Zugewanderten „Starthilfe“: Flughafenabholung, Vermittlung eines Wohnheimzimmers, Hilfe bei Behördengängen, Internetanschluss und SIM-Karte, Ikea-Haushalts-Starterkit und WhatsApp-Betreuung bei allen Alltagsfragen – von GEZ bis Steuer-ID. „Wir lernen seit 13 Jahren von Gruppe zu Gruppe dazu“, sagt Tanja Hofmann. „Während wir den ersten Tunesierinnen und Tunesiern noch ein Frühstück anboten, mitten im Fastenmonat Ramadan, und der philippinischen Gruppe die Fahrradstadt Erlangen anpriesen – ohne zu wissen, dass sie zum Teil noch nie in ihrem Leben Fahrrad gefahren waren –, werden wir von Mal zu Mal besser.“ Die Integration sei für alle – die Zugewanderten und die Stammteams vor Ort – „ein immenser Aufwand. Aber er ist nötig“, betont Tanja Hofmann noch einmal. Lena Kellner gibt zu bedenken: „Das sind Menschen, die ihr Leben in zwei Koffer gepackt haben. Die Familien, teilweise kleine Kinder, in ihrer Heimat zurücklassen, um hier neu anzufangen. Machen wir uns deshalb immer wieder bewusst, dass Pflegende auf der ganzen Welt letztlich dasselbe wollen: für andere da sein und Fürsorge geben.“
Diverse Gesellschaft – diverses Gesundheitssystem
30 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Damit werden auch Kliniken – ihre Beschäftigten und ihre Patientenklientel – immer diverser. Häuser, die sich dem öffnen, sind zukunftsfähiger, flexibler und finden bessere Lösungen für alle. Sie sind als Arbeitgeber für (internationale) Fachkräfte attraktiver und können gleichzeitig besser auf Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Herkunft und Kultur eingehen. In kultursensiblen Krankenhäusern gibt es weniger Missverständnisse. Sie gewinnen eher das Vertrauen von Patientinnen und Patienten und Therapien lassen sich erfolgreicher umsetzen.
Das Uniklinikum Erlangen wird bunter
Eine strategische internationale Pflege-Akquise gibt es am Uniklinikum Erlangen seit 2012. In der ersten Einstellungsrunde kamen Pflegefachkräfte aus Spanien; es folgte Verstärkung aus Italien, von den Philippinen, aus Bosnien und Herzegowina, Tunesien und Indien. Immer wieder wurden auch einzelne Fachkräfte aus Serbien, Polen, Albanien und vielen anderen Ländern eingestellt. Rund 70 Prozent dieser Zugewanderten sind bis heute am Uniklinikum Erlangen beschäftigt. Insgesamt arbeiten hier – über die Pflege hinaus – Menschen aus 113 Nationen.
Öfter mal die Perspektive wechseln
Unsere Interpretation der Realität ruft immer bestimmte Gefühle hervor. Diese wiederum bringen uns zum Handeln. Laut Kulturexpertinnen wie Silke Ettling geht es darum, immer wieder die eigene Perspektive zu wechseln: Ist dieses aufbrausende Verhalten der Patientenfamilie wirklich Wut oder einfach nur Verzweiflung, aus Sorge um einen Angehörigen? Signalisiert der fehlende Blickkontakt der zugewanderten Mitarbeiterin tatsächlich Desinteresse oder könnte es auch ein Ausdruck gelernter Höflichkeit sein? Ist es eine unverschämte Lüge, wenn eine Person sagt „Ja, mache ich“ und dann eine Aufgabe nicht erledigt? Oder zeigt diese Rückmeldung Respekt gegenüber einer Autoritätsperson, der nicht widersprochen werden sollte? Ist es unverantwortlich, wenn Angehörige einem Patienten seine schwere Diagnose verschweigen und stellvertretend für ihn alles regeln wollen, oder gilt das in anderen Kulturen eventuell als fürsorglich? Lehnt eine Frau eine bestimmte Untersuchung grundsätzlich ab oder könnte sie diese kulturbedingt tolerieren, wenn eine weibliche Person sie durchführt? „Wenn wir unsere Sichtweise ändern, verändern sich unsere Gefühle gegenüber anderen und es eröffnen sich neue Möglichkeiten“, sagt Silke Ettling. „Es gibt eigentlich nie richtig oder falsch, immer nur anders.“
Text: Franziska Männel/Uniklinikum Erlangen; Fotos: Franziska Männel/Uniklinikum Erlangen; zuerst erschienen in: Magazin „Gesundheit erlangen“, Sommer 2025