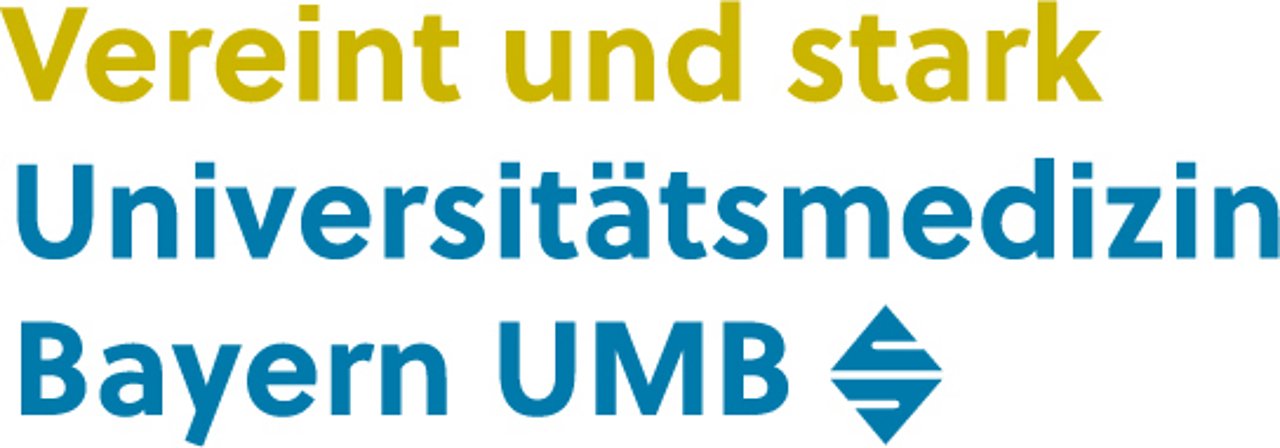Damit im OP stets mit sauberen Instrumenten gearbeitet werden kann, gibt es einen aufwendigen und akribisch dokumentierten Prozess. Ein Besuch in der zentralen Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte des Uniklinikums Erlangen.
Hygiene ist das A und O im Krankenhaus. Von der sterilen Schere für den Verbandswechsel auf Station bis hin zu Klemmen, Haken und Schrauben zur Operation nach einem Unfall – in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) im Chirurgischen Zentrum des Uniklinikums Erlangen sorgen pro Schicht fünf bis sechs Mitarbeitende dafür, dass chirurgische Instrumente nach ihrer Benutzung vorgereinigt, desinfiziert, überprüft, sortiert, verpackt, sterilisiert und kommissioniert werden. Hazal Ersoy nimmt die Redaktion von „Gesundheit erlangen“ heute für einen Vormittag mit in die AEMP, die im dritten Stock direkt neben dem OP-Bereich liegt.
Die Objektleiterin trägt einen blauen Kasack mit passender Hose und eine lila Haube. Sobald sie den „unreinen Bereich“ betritt, in dem sie die benutzten Instrumente entgegennimmt, zieht sie sich rote Gummischuhe, einen gelben, wasserdichten Kittel, einen Mundschutz mit integriertem Visier und lange violette Handschuhe an. „Das ist meine persönliche Schutzausrüstung. Damit verhindere ich den Kontakt mit kontaminiertem Material und möglichen Spritzern“, erklärt Hazal Ersoy, während sie den ersten Metallwagen entgegennimmt, den das OP-Personal gerade hereinrollt. Er ist beladen mit Containern, die aussehen wie übergroße Geldkassetten mit Henkeln. Die Sterilisationsassistentin öffnet einen der Behälter und entnimmt ein Sieb voller OP-Besteck. „Als Erstes kontrolliere ich, wie verschmutzt die Instrumente sind“, sagt sie mit einem prüfenden Blick. „Jetzt verteile ich alles gleichmäßig, damit das Besteck überall sauber wird, und kennzeichne zusammengehörige Sets“, sagt Hazal Ersoy. Sie lässt das Sieb im Ultraschallbad abtauchen, um die gröbsten Verunreinigungen zu lösen, und steckt rote Kunststoffmarkierungen an weitere Behälter. Die vorgesäuberten Siebe stellt die 29-Jährige nach der manuellen Vorreinigung auf einen zweiten Wagen, den sie gleich in eine Art Spülmaschine schieben wird, sobald er voll ist.
Reinigen und desinfizieren
„Die Dokumentation ist bei uns extrem wichtig“, betont Hazal Ersoy, während sie nach dem Handscanner greift und wie an der Supermarktkasse – piep, piep, piep – die Barcodes an den Sieben einliest und auf dem Bildschirm die Bezeichnung der Sets überprüft. „Damit stellen wir sicher, dass alle Reinigungsschritte ordnungsgemäß durchgeführt werden und jedes Instrument im richtigen Sieb und an der korrekten Stelle landet.“ Die Objektleiterin drückt einen Knopf am RDG, dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät, und dessen Glastür fährt langsam nach oben. Hazal Ersoy schiebt den Wagen hinein und startet das Programm. Eine Stunde und sieben Minuten kündigt das RDG die Dauer an, als die ersten Spülgeräusche zu hören sind und das Wasser wie in einer Autowaschanlage an der Scheibe herunterläuft. „Das Programm spült vor, reinigt mit einem speziellen Mittel und desinfiziert anschließend die Instrumente. Dabei erreicht das Gerät Temperaturen von 93 Grad“, erklärt Hazal Ersoy die Prozedur. Sie greift nach einem Desinfektionstuch und säubert den Wagen, auf dem die unreinen Materialien aus dem OP kamen, und die Metallcontainer gründlich, sodass die sterilisierten Instrumente später wieder damit transportiert werden können.
Prüfen, sortieren, verpacken
Hazal Ersoy nimmt Handschuhe, Kittel und Maske ab, tauscht die roten gegen gelbe Gummischuhe und wechselt zur nächsten Station: zum Packbereich. Sie streift sich einen Silikonhandschuh über, der einem Ofenhandschuh aus der Küche ähnelt, und zieht den noch heißen Instrumentenwagen mit den sauberen Sieben aus dem RDG. Nun kommt wieder ein Handscanner zum Einsatz: Hazal Ersoy überprüft, ob beim Reinigungsablauf alles O. K. war und die gewünschten Temperaturen erreicht wurden. „Erst dann gebe ich die Reinigungs-Charge frei. Passt etwas nicht, muss der Wagen den Reinigungsprozess noch einmal durchlaufen.“ Da alles geklappt hat, räumt die Sterilisationsassistentin die Siebe in hohe Rollwagen ab. „Dabei achte ich wieder auf zusammengehörige Sets und ordne sie nach OP-Bereich“, sagt sie und deutet exemplarisch auf einen Wagen für die Unfallchirurgie-Orthopädie und die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und einen für die Gefäß- und die Herzchirurgie.
Als Nächstes packt Hazal Ersoy ein „Knochensieb“: „Quasi ein Standardbesteck in der Unfallchirurgie – da sind ja in der Regel Knochen beteiligt, daher der Name.“ Anhand der Siebpackliste am Bildschirm überprüft sie genau, ob die einzelnen Instrumente in der nötigen Anzahl vorhanden sind. Klack, klack, klack – mit geübter Hand sortiert Hazal Ersoy die Klemmen und Scheren, die für das Laienauge bis auf die gold- und silberfarbenen Griffe alle gleich aussehen, in zehn Haufen, zählt jeden einzelnen durch, überprüft Funktionsfähigkeit sowie Sauberkeit jedes Teils und ölt hier und da ein schwergängiges Scharnier. Ihr Blick schnellt zwischen den Instrumenten und der Liste auf dem Monitor hin und her. Zehn Tuchklemmen stumpf, 150 mm lang, vier Peanklemmen gebogen, 160 mm, zwei Moskitoklemmchen gerundet, 125 mm. Dazu kommen 70 weitere Teile wie Kornzangen und Nadelhalter. Wie viele verschiedene Arten von chirurgischen Instrumenten es wohl gibt? Fünfhundert? Tausend? „Das reicht bei Weitem nicht“, lächelt Hazal Ersoy und deutet auf den Bildschirm. „Es gibt zu jeder Bezeichnung ein passendes Bild, falls man mal unsicher ist.“ Anhand der Packliste sortiert sie das Besteck anschließend fein säuberlich ins Sieb, denn jedes Teil hat seinen festen Platz, damit die Operateurin oder der Operateur das gewünschte Werkzeug im Notfall auch „blind“ findet.
Doppelt eingetütet
Zwei Meter weiter raschelt es: Hier wandern Einzelinstrumente wie Scheren, Spülflaschen und Klemmen in Verpackungen aus zartblauem Papier und Folie. Diese schiebt Hazal Ersoy dann durch ein Gerät, das aussieht wie ein Laminierer und den Inhalt verschweißt. Anschließend kommt das Instrument in eine zweite Tüte, die abermals verschlossen wird. „Nur so können wir eine aseptische Entnahme garantieren, bei der kein einziger Keim mit dem Patienten in Berührung kommt“, erläutert die Objektleiterin und schiebt einen mit Sieb-Containern und Folientüten beladenen Rollwagen zum Sterilisationsgerät. „Wir benutzen hier ein fraktioniertes Vakuumverfahren zum Sterilisieren. Das Gerät arbeitet dafür mit Unterdruck und Dampfstößen, die 134 Grad heiß sind“, fügt Hazal Ersoy an, während sie zum vierten Mal an diesem Vormittag zum Handscanner greift und Sieb für Sieb, Tüte für Tüte die Strichcodes einliest. Piep, piep, piep. Hinter dem Wagen schließt sich die stählerne Tür des Sterilisators, der mehrfach die vorhandene Luft absaugt, heißen Wasserdampf generiert und schließlich alle Instrumente trocknet.
Im Sterilgutlager
Die Objektleiterin geht weiter in den dritten und letzten Bereich der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte: „Im Sterilgutlager schaue ich noch mal auf die Dokumentation und gebe das Material frei, sofern alles passt“, erklärt Hazal Ersoy. Sie öffnet einen der deckenhohen Schränke, die voll sind mit sterilen Folientüten und Sieben. Alles hat seine klare Ordnung, damit OP-Pflegekräfte selbstständig spontan benötigte Instrumente mit in einen der Operationssäle nehmen können, die hinter der metallenen Automatiktür liegen. In drei gekennzeichneten Schränken stehen außerdem immer Notfallwagen für allgemeinchirurgische, (kinder-)herzchirurgische und gefäßchirurgische Notfälle parat. Die Sterilisationsassistentin deutet auf eine Tafel neben der Automatiktür. „Dort bestellt der OP die benötigten Instrumente.“ Je nach Eingriff können das „Tumorsiebe“, „Grundsiebe“, „Knochensiebe“ und viele mehr sein. „Wir stellen ihnen das Material entsprechend zusammen. Mit speziellen Wagen werden die Instrumente dann zum Einsatzort im OP gebracht“, sagt Hazal Ersoy. So schließt sich der Kreis, bis Instrumente, Schüsseln und Spülfläschchen nach ihrer Benutzung erneut in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte landen.
Text: Alessa Sailer/Uniklinikum Erlangen; Fotos: Michael Rabenstein/Uniklinikum Erlangen; zuerst erschienen in: Magazin „Gesundheit erlangen“, Sommer 2023
4 Stunden
… dauert es, bis das Material, das direkt aus dem OP kommt, wieder steril und bereit für seinen nächsten Einsatz ist.
Desinfektion und Sterilisation
Während die Desinfektion v. a. krankmachende Keime reduziert und so deren Weiterverbreitung unterbindet, werden beim Sterilisieren alle Mikroorganismen, also auch nicht-krankmachende Keime und ihre Sporen, vollständig eliminiert.
15.993
… unterschiedliche wiederaufbereitbare Medizinprodukte sind am Uniklinikum Erlangen im Umlauf – diese sind wiederum in mehrfacher Ausführung vorhanden, je nach Teil Dutzende oder Hunderte Male.
Nachhaltigkeit zählt
Am Uniklinikum Erlangen werden kaum Einmalbestecke verwendet, sondern i. d. R. hochwertige Metallinstrumente, die sich wiederaufbereiten lassen. Bei schwer zu reinigenden Teilen wie engen Spülkanülen wird dagegen aus Hygienegründen auf Einmalprodukte gesetzt.
Zwei Standorte
Die AEMP ist für das gesamte Chirurgische Zentrum, die Strahlenklinik und die Frauenklinik zuständig. Außerdem gibt es noch eine Sterilgutaufbereitung in den Kopfkliniken, die sich um die Instrumente aus Neurochirurgie, Augenklinik, Hautklinik, HNO-Klinik und deren Stationen kümmert.
Mit dem Laden des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.