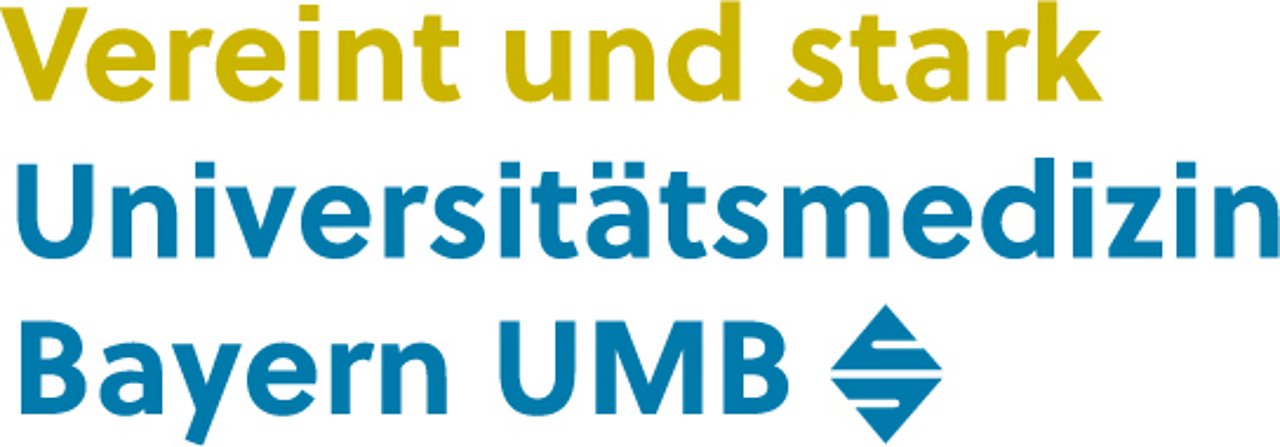Aktuelle Presseinformationen
Hier finden Sie die jeweils aktuellsten Nachrichten aus dem Uniklinikum Erlangen. Eine vollständige Übersicht über alle Meldungen bekommen Sie im jeweiligen Archiv.
Mit Organoidmodellen, Zellmerkmalen und Zebrafischen gegen Krebs
Bayerisches Zentrum für Krebsforschung am Standort Erlangen fördert drei Projekte zur gezielteren Behandlung von KrebserkrankungenTod durch oder mit COVID-19
Erlanger Pathologinnen und Pathologen informieren in Bürgervorlesung über ihre ErfahrungenFranz-Volhard-Medaille für Kerstin Amann
Erlanger Professorin als erste Frau mit höchster Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie geehrtWie unsere Muskeln funktionieren
Erlanger Forschungsteam entschlüsselt die Mikrotubuli-Organisation in MuskelnEhre für Erlanger Nephropathologin
Prof. Dr. Kerstin Amann zum Ehrenmitglied der Polnischen Gesellschaft für Nephrologie ernanntHerzgewebe aus dem 3D-Drucker
Manfred-Roth-Stiftung spendet 30.000 Euro – Forschungsstiftung Medizin ergänzt um 10.500 EuroKrankheitsmechanismen für maßgeschneiderte Therapien von Nierenerkrankungen aufdecken
Nephropathologie und Medizin 4 sind an SFB-Projekt in der Nierenforschung mit einer Gesamtförderung von 11,3 Millionen Euro beteiligtForscher will Nierenerkrankungen aufhalten
Für seine Doktorarbeit erhält Dr. Sebastian Röder den Georg-Haas-Preis des Verbands Deutsche Nierenzentren e. V.Spurensuche in Sri Lanka
Erlanger Ärzte unterstützen Forschungsprojekt zur Aufklärung von NierenerkrankungenEin Herz aus Spinnenseide
Forscher aus Erlangen und Bayreuth untersuchen Spinnenseidenprotein zur Herstellung von künstlichem HerzgewebeSortierung nach Einrichtungen
- Uniklinikum
- Allgemeinmedizin
- Anästhesiologie
- Apotheke
- Augenklinik
- CCC Erlangen-EMN
- CCS
- Chirurgie
- Deutsches Zentrum Immuntherapie
- Experimentelle Therapie
- Frauenklinik
- Gefäßchirurgie
- Hautklinik
- Herzchirurgie
- HNO-Klinik
- Humangenetik
- Immunmodulation
- Infektionsbiologie
- Kieferorthopädie
- Kinderchirurgie
- Kinderkardiologie
- Kinderklinik
- Kinderpsychiatrie
- Medizin 1
- Medizin 2
- Medizin 3
- Medizin 4
- Medizin 5
- MIK
- Mikrobiologie
- Mikrobiomik
- MKG-Chirurgie
- Molekulare Neurologie
- Molekulare Pneumologie
- Nephropathologie
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Neuropathologie
- Neuroradiologie
- Nuklearmedizin
- Palliativmedizin
- Pathologie
- Plastische/Handchirurgie
- Psychiatrie
- Psychosomatik
- Radiologie
- Stammzellbiologie
- Strahlenklinik
- Thoraxchirurgie
- Transfusionsmedizin
- Translationale Immunologie
- Unfallchirurgie-Orthopädie
- Urologie
- Virologie
- Zahnerhaltung
- Zahnärztliche Prothetik
- Zentrallabor